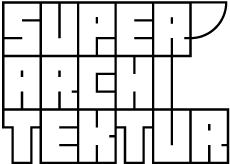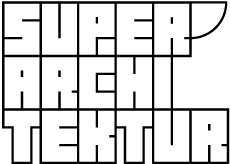WB BRÜCKE HOLZGARTENSTEG
REGENSBURG
1. PRIZE

Der Holzgartensteg Regensburg als Bereicherung des öffentlichen Raums
Der Holzgartensteg ist nicht nur ein logischer Lückenschluss im Verkehrskonzept für die sanfte Mobilität der Stadt Regensburg – er ist wesentlicher Zeil des öffentlichen Raumes.
Im Bestand weist der öffentliche Raum im Bereich Grieser Spitz sowie Maria-Beer-Platz unterschiedliche Nutzungen sowie Qualitäten auf. Wird der Bereich am Grieser Spitz sowohl als Ruhezone, als auch als Sport- und Spielbereich genutzt, so ist die Uferpromenade am Maria-Beer-Platz bereits jetzt vor allem der sanften Mobilität zuzuschreiben (Spazieren, Laufen, Radfahren).
Ziel des Entwurfes war es, die bestehenden Qualitäten des öffentlichen Raumes nicht nur sensibel zu bewahren, sondern sogar zu unterstützen und zu fördern.
Maria-Beer-Platz / Reinhausener Damm
Der Maria-Beer-Platz weist bereits im Bestand eine ablesbare Mittelzone auf, welche Barcodeartig in unterschiedliche Bereiche (Aufenthaltsbereich, Gräser, Bäume) geteilt ist. Derzeit trennt der Geh- und Radweg den Platz vom Wasser. Zudem gelangt man nur über die wiesenbewachsene Böschung zum Wasser und dem attraktiven, uferbegleitenden Pfad. Durch einen ablesbaren Bruch im Bodenbelag wird der Platz bis an die Böschung gezogen. So wird der Platz für querende RadfahrerInnen als Shared Space wahrnehmbar. Im Anschlußbereich an die Böschung wird in Fortsetzung der geschwungenen Formen der Brücke in einer großzügigen Geste sowohl ein Zugang zum Flussufer als auch jener auf den Holzgartensteg angeboten. Die Treppe auf die Brücke öffnet sich zum Platz und bietet mit Sitzstufen eine dem Platz zugewandte Tribüne – Raum um zu sitzen und dem Treiben am Platz zuzusehen. Eine mit Sitzstufen durchzogene Freitreppe über die Böschung zum Uferweg verbindet konsequent den Fluss mit dem Platz.
Im Vorliegenden Entwurf gelingt es RadfahrerInnen so zu leiten, dass sie den Maria-Beer-Platz nicht queren müssen, während FußgängerInnen direkten Zugang dazu haben. RadfahrerInnen, welche von westen her kommen oder dort hin wollen haben eine großzügige Wendemöglchkeit, es kann aber nicht zur Situation kommen, dass diese in hohem Tempo von der Rampe über den Maria-Beer-Platz fahren.
Grieser Spitz
Die Situierung der Brücke, welche beinahe exakt am bestehenden Weg startet, erlaubt es ein Maximum an bestehenden Bäumen zu erhalten. Die Qualität des naturnahen Ufers im Süden am Grieser Spitz wird durch die Situierung der Brücke nicht nur erhalten, sondern durch die entstehende Zonierung als Ruhezone aufgewertet. Die Rampen werden im Anfangsbereich an beiden Seiten angeböscht um auch diese Bereiche mit eingebetteten Sitzstufen nutzbar zu machen. Am Grieser Spitz wird der vorhandene Platz aufgewertet. Podeste, die zum Ufer am Spitz führen, laden zum Verweilen ein. Der Holzgartesteg nimmt hier keinen Raum, stattdessen wird er zu einer niederschwelligen Zonierung sowie einer qualitativen Ergänzung der Nutzungsbereiche herangezogen. Im Bereich des Bolzplatzes wird eine Geländemodellierung zur Trennung des Fuß- und Radweges vom Bolzplatz errichtet. In diese können beidseits Sitzstufen eingelassen werden, sowohl für fußballinteressierte ZuseherInnen als auch für jene, die den Blick aufs Wasser suchen.
Tragwerkskonzept
Als Brückentragwerk ist eine einseitig abgehängte rückverankerte Hängebrückenkonstruktion vorgesehen. Die Haupttragseile aus vollverschlossenen Spiralseilenwerden mit Gabelseilhülsen an 20 m hohe Pylone abgehängt und folgen der S-Form der Brücke. Die Pylone sind direkt innenliegend an der größten Krümmung der S-Form geneigt platziert. Um die Pylonspitze zu fixieren, sowie die durch die Krümmung erzeugte Kraftkomponente auszugleichen, wird in der Winkelhalbierenden die Mastspitze rückverhängt. Die Gründung der Rückverhängung, die Pylone und die Rampenwiderlager werden mit Bohrpfählen bzw. Zuganker im Baugrundverankert.
Der Brückenüberbau besteht aus einem ca. 60 cm hohen geschlossenem Stahlhohlkasten mit Querrippen im Abstand von ca. 4 m. Die Brückenbreite variiert zwischen den Pylonen bei 5m lichter Gehbreite kontinuierlich abnehmend bis zu 4m an den Rampen und Widerlagern. Das obere Blech ist als orthotrope Stahlplatte mit Längsrippen ausgebildet. Durch die torsionssteife Ausführung wird die einseitige Aufhängung des Decks kompensiert. Die S-Form begünstigt dabei durch den Wechsel der Abhängung in Brückenmitte die Torsionslagerung.
Grundgedanken der Freiraumgestaltung:
Das Konzept des Maria-Beer-Platzes wird bis zur neuen Brücke fortgeführt. Somit bleibt die Offenheit und die gute Einsicht für alle Beteiligten im Transitraum bestehen. Gleich einer neuen Stadtterrasse öffnet sich der Platz über zwei großzügige Treppenanlagen, die einerseits die Brücke und andererseits den tiefer gelegenen und dem zum Wasser zugewandten, informelleren Spazierbereich anbinden. Sitzelemente laden zum Verweilen ein und werden von Staudenbeeten gerahmt. Ein neuer Treffpunkt für das gemeinsame Miteinander wird geschaffen. Der neue Aufenthaltsbereich wird auch durch einen bewusst gesetzten Materialwechsel von der übrigen geschotterten Bewegungsachse unterbrochen. Vor allem die Radfahrer sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie hier keinen reinen Transitraum passieren und auf die anderen Benutzer Rücksicht nehmen müssen. Die Radfahrer können auch weiterhin ohne Barriere über den östlichen Teil des Platzes geleitet werden. Ein großzügig dimensionierter 6m Radius ermöglicht die gefahrenlose Richtungsänderung und die Auffahrt zur Brücke.
Durch das naturnahe Erscheinungsbild des Grieser Spitzes wird die Anschlusssituation der Brückenrampe in diesem Bereich über eine natürliche Geländemodellierung gelöst. Diese Anböschung ermöglicht zu beiden Seiten eine fußläufige Anbindungder Erholungs- und Aufenthaltsflächen. Sitzelemente werden in die begrünte Böschung eingeschoben, laden zum Verweilen ein und ermöglichen eine erhöhte Aussicht über den Grieser Spitz.
Auch die vorhandenen Wege werden weitgehend berücksichtigt und verbreitert. Die Umgestaltung der Wegeführung soll nicht nur als reines Verbindungselement dienen, sondern zum Flanieren einladen. Da im Bestand ein Trampelpfad am südlichen Ufer vorzufinden ist, welcher Zugang zum Wasser wie auch ein ufernahes Spazieren ermöglicht, wird im Entwurf auf den oberen Weg verzichtet. Stattdessen ist eine Grünraumerschließung Richtung Norden zum bestehenden Weg entlang der Kaimauer geplant.
Auf den Grünflächen werden Liege- und Sitzelemente situiert, wie auch entlang der Wege, die zur stillen Erholung beitragen. Die Oberflächen sind teilweise mit Holzauflagen sowie Rücken- und Armlehnen bestückt, sodass ein komfortables Verweilen für Jung und Alt geboten ist. Entlang des Radwegs werden die Randbereiche des Bolzplatzes mit kleinen, sich überlappenden Geländemodellierungen versehen, um eine natürliche Ball-Barriere auszubilden. Integrierte naturnahe Sitzelemente, wie z.B. Holzstämme, laden zum Zuschauen und als Rastplatz ein.
Durch die großzügigen Staudenbeete werde zum einen der lichte Raum unter den Rampen bepflanzt. Zum anderen wird durch deren Form ein abwechslungsreiches Bild von der Brücke auf den darunterliegenden Platz geschaffen. Eine Gräserpflanzungsoll hier das Thema der Leichtigkeit der Brücke aufgreifen.
Als Kommunikationspunkt dient der östliche Teil des Grieser Spitz. Inbegriffen ist die Wendeanlage, die sich unter der Brücke befindet und welche als kleiner Platz fungiert. Die Brücke bietet eine Überdachung für die Aufenthaltszone sowie eine attraktive Beschattung im Sommer mit nach wie vor freiem Blick nach Osten. Auf grund dessen wird ein Bereich für kleinere Veranstaltungen wie Flohmärkte, Grillfeiern etc. geschaffen.
Der vorher triste Punkt über der Spundwand wird zu einem Aussichtspunkt umgestaltet. Das unterste Plateau ist barrierefrei, wie auch über eine Treppe zu erreichen. Der neue Aufenthaltsort besticht durch eine Terrassierung, welche als gemütliche Liege- und Sitzmöglichkeit dient.
BELEUCHTUNG
Das Beleuchtungssystem der Brücke setzt sich aus hoch effizienten durch asymmetrischen Linsensysteme gut entblendeten Leuchten an den Pylonen und Tragseilen und einem in den Handlauf integrierten linearen homogen leuchtenden Beleuchtungssystem zusammen.
Farbe und Reflexionseigenschaften des Belages sind auf die Farbtemperatur der Beleuchtung abgestimmt, um den Geh- und Radweg der Brücke möglichst gleichmäßig hell erscheinen zu lassen und damit das individuelle Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
Zusätzlich verbessert das weiche Reflexionslicht den Anteil der zylindrischen Beleuchtungsstärkeund damit die sogenannte Gesichtserkennung.
Ein intelligentes Lichtmanagement steuert die unterschiedlichen Beleuchtungselemente und kombiniert sie dynamisch in Abhängigkeit von zum Beispiel ungünstigen Witterungsverhältnissen oder besonders stimmungsvollen Nachtlichtverhältnissen.
Diese verhältnismäßige Abstimmung der Beleuchtungsstärken sowie spezielle Anforderungen an Schutzklasse, Farbspektren und optische Systeme berücksichtigen insbesondere Aspekte der Lichtökologie und tragen damit zum Schutz der Insekten und der Reduzierung des Lichtsmogs bei. Damit gibt die Beleuchtung des Holzgartenstegs den Passanten Sicherheit und Orientierung, erzeugt eine einladende und reizvolle Atmosphäre und schafft einen Ort mit hoher städtischer Aufenthaltsqualität auch in der Nacht.